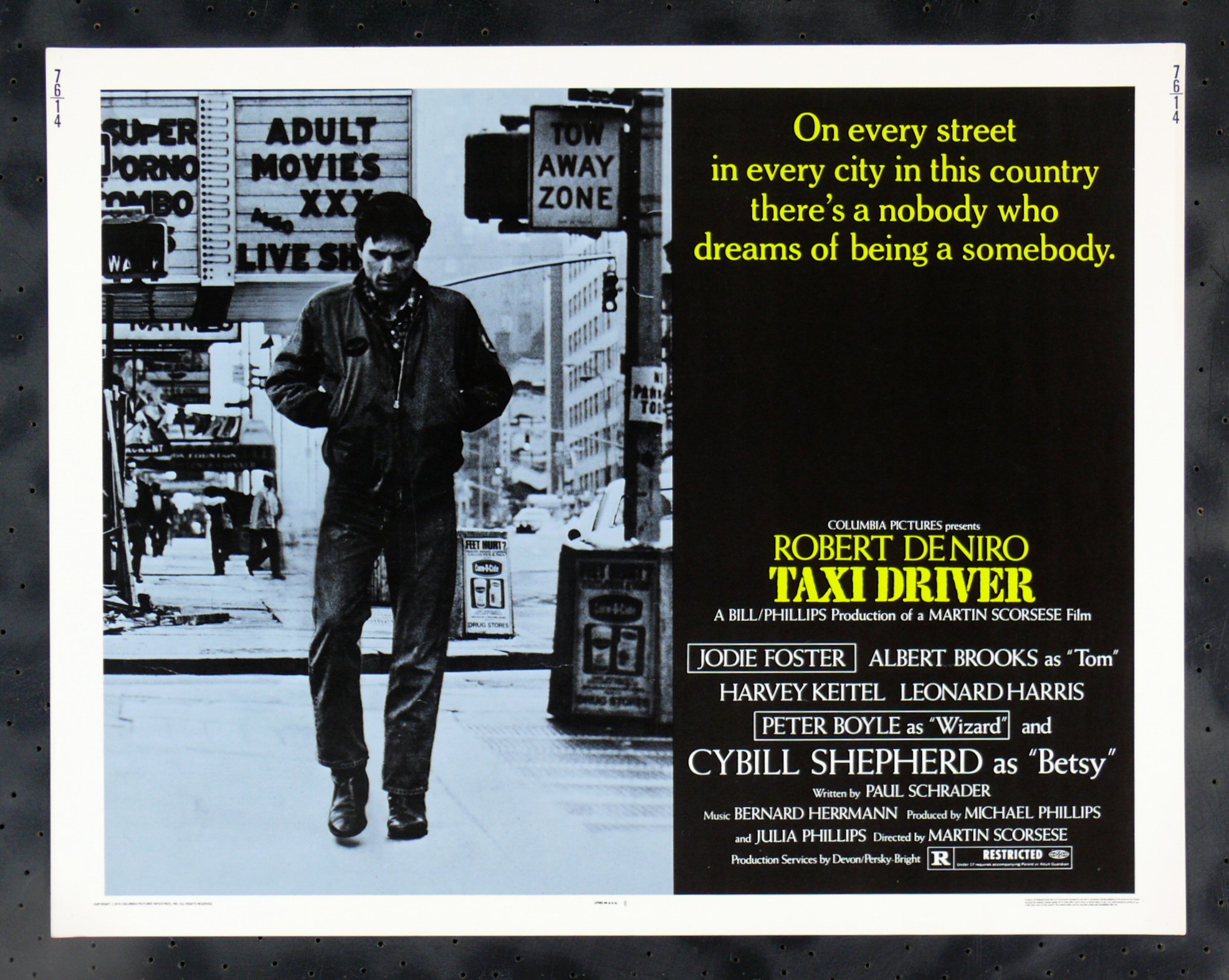Fakten:
Phantastische
Tierwesen und wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts and Where to
Find Them)
GB/US,
2016. Regie: David Yates. Buch: J.K. Rowling. Mit: Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Ezra
Miller, Carmen Ejogo, Samantha Morton, Jon Voight, Johnny Depp, Ron
Perlman u.a. Länge: 132 Minuten. FSK: Freigegeben ab 6 Jahren. Im
Kino.
Story:
Newt
Scamander ist ein britischer Zoologe mit magischen Kräften und
befasst sich Anfang des 20. Jahrhunderts in New York mit der
Erforschung und Systematisierung magischer Kreaturen. Dafür scheut
er keine Mühen und erlebt auf seinen Reisen so manches gefährliche
Abenteuer. Im New York des Jahres 1926, wo Zauberer ihre Offenbarung
vor der Muggel-Bevölkerung fürchten, trifft er im Zuge seiner
Studien auf die amerikanischen Hexenschwestern Porpentina und
Queenie, aber auch auf den Muggel Jacob und gefährliche Gegner wie
Percival Graves.
Meinung:
Das
magische Universum von J.K. Rowling scheint einfach nicht ruhen zu
wollen. Nachdem die Geschichte des Zauberlehrlings Harry Potter nach
sieben Büchern und acht Filmen vorerst ein Ende fand, erfuhr sie
zugleich eine Weiterführung in Form des Theaterstücks "Harry
Potter and the Cursed Child", dessen Skript Ende 2015 in
Buchform veröffentlicht wurde, bevor es 2016 in London erstmals
uraufgeführt wurde.
 |
| Für Turteleien bleibt schnell kaum noch Zeit |
Auch im Kino erfährt die verzauberte Welt
von Rowling in diesem Jahr eine Wiederbelebung, wenn auch ohne den
sympathischen Zauberer mit der Narbe auf der Stirn. Für "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" hat die Autorin nun zum ersten
Mal ein Filmdrehbuch geschrieben, in dem sie in der Zeit zurück
führt, ins New York der 20er Jahre, wo der aus England angereiste
Zauberer und Zoologe Newt Scamander einen ganz persönlichen Plan
verfolgt. Der bereits jetzt auf fünf Teile ausgelegte Film, bei dem
Potter-Veteran David Yates erneut auf dem Regiestuhl Platz nahm,
erweist sich dabei als angenehm energiegeladener Blockbuster, in dem
auf unnötigen Fanservice verzichtet und stattdessen eine
eigenständige Geschichte erzählt wird. "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" hat den großen Vorteil, dass er zu
keinem Zeitpunkt wie ein lieblos produzierter Aufguss bekannter
Elemente wirkt und trotzdem schon nach wenigen Minuten ein vertrautes
Gefühl entfacht, spätestens wenn die ersten Töne des Scores von
James Newton Howard erklingen. Rowling entwirft ein interessantes
Setting, in dem sie fantasievolle Einfälle, unverbrauchte sowie
detailgetreu entworfene Schauplätze und überraschende Bezüge zum
aktuellen Politik- und Zeitgeschehen zu einem dynamischen Abenteuer
verbindet.
 |
| Ron Perlman. Erkannt? |
Im Mittelpunkt steht dabei Newts Mission, eines seiner
vielen Tierwesen, die er in einem Koffer mit sich transportiert, zu
dessen Heimatort zurückzubringen und in die Freiheit zu entlassen.
Als er seinen Koffer versehentlich mit dem des Fabrikarbeiters Jacob
vertauscht, der kein Magier ist, gelangen einige der Kreaturen in die
Öffentlichkeit und sorgen mitunter für heilloses Chaos. Der
Charakter des Newt Scamander erweist sich dabei als regelrecht
unkonventionelle Wahl für den Protagonisten und gleichzeitig
Sympathieträger eines ganzen Franchises. Mit seiner introvertierten,
eingeschüchterten Art, bei der er seinem menschlichen Gegenüber
kaum in die Augen schauen kann, während ihm die eigenen Sätze
oftmals vernuschelt aus dem Mund purzeln, wirkt er in manchen Szenen
des Films fast schon wie ein sozialer Problemfall. Dass für diese
Figur ausgerechnet Eddie Redmayne besetzt wurde, wirkt daher fast
schon wieder wie ein klug erdachter Schachzug. Redmayne zeigt sich
auch in diesem Film wieder als äußerst limitierter Schauspieler,
der mit seiner oftmals ans groteske Grimassieren erinnernden Mimik
wie erstarrt und verzerrt zugleich auftritt. Ein Erscheinungsbild,
das paradoxerweise stimmig zu seiner Figur passt, während der
Schauspieler in den Szenen, in denen er mit seinen hoch geschätzten
Tierwesen interagiert, nichtsdestotrotz eine gewisse Wärme sowie
verschmitzten Charme ausstrahlt.
 |
| Dieser Zeitgenosse stiehlt allen die Show |
Die Jagd nach den entflohenen
Kreaturen erweist sich unter der Regie von Yates als überaus
unterhaltsame Odyssee, bei der Rowling ein aufsehenerregendes
Geschöpf nach dem anderen aus dem Hut zieht, während diese mit CGI
auf tolle Art und Weise zum Leben erweckt wurden. Durch die
verschrobene Dynamik, die zwischen dem eigenwilligen Zoologen und dem
No Maj (amerikanisch für Muggel) Jacob, der überwiegend als Comic
Relief fungiert, entsteht, zu der sich außerdem noch Katherine
Waterston als Ex-Aurorin und Alison Sudol als deren Schwester
hinzugesellen, verkommt "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" zu leichtfüßigem Eskapismus, bei dem einige der
Kreaturen wie beispielsweise der maulwurfartige "Niffler",
der nach glänzenden, glitzernden Gegenständen süchtig ist, immer
wieder die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich ziehen. Rowling
belässt es allerdings nicht bei diesem Handlungsstrang und
verheddert sich etwas in den Nebensträngen, in denen die Autorin
zunehmend düstere Seiten aufzieht.
 |
| Eher ungewohnte Aussichten im Central Park |
Während die Momente, in denen
die Todesstrafe an Zauberern als bedrückendes Konzept präsentiert
sowie ein Zusammenleben zwischen Zauberern und No Majs als
gesellschaftliches Tabu etabliert wird und ein mysteriöser schwarzer
Magier Angst und Schrecken verbreitet, einen gelungenen Kontrast zum
heiteren Handlungsstrang von Newts Gruppe darstellen, bekommt die
Autorin den Bogen zwischen diesen Einzelgeschichten nicht immer
schlüssig gespannt. Unter anderem verkommt die Geschichte der von
Samantha Morton gespielten Frau, die eine neue Sekte im Sinne der
Salem-Bewegung leiten will, bei der Hexen und Magier als ernsthafte
Bedrohung verfolgt werden sollen, zur beiläufigen Randnotiz, die ein
abruptes Ende findet. Auch das Finale, in dem sich der Streifen
eindeutigen Blockbuster-Konventionen unterordnet, wenn ganze Gebäude
nacheinander zum Einsturz gebracht werden, erinnert zu sehr an plumpe
Zerstörungsorgien der Marvel-Superheldenfilme.
Als Auftakt eines
völlig neuen, eigenständigen Universums funktioniert "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" trotz der erzählerischen
Unebenheiten als stimmungsvoller Blockbuster, in dem J.K. Rowling als
Drehbuchdebütantin viel fantasievolles Gespür für unterhaltsame
Einzelheiten unter Beweis stellt. Neben der ausgelassenen Jagd auf
die toll gestalteten Zauberwesen überrascht der Streifen mit einigen
düsteren Einlagen, ist treffend besetzt und fühlt sich aufgrund der
liebevollen Ausstattung und dem wohligen Score von James Newton
Howard frisch und vertraut zugleich an.
7 von 10 überraschend geräumige Koffer
von Pat