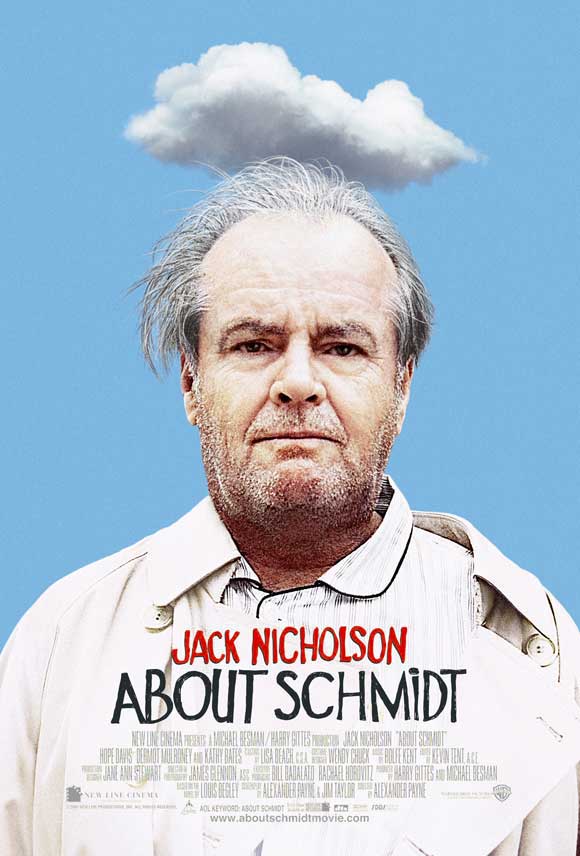Fakten:
Titanic.
US. 1997. Buch und Regie: James Cameron. Mit: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher, David Warner, Jonathan Hyde, Charlotte Chatton, Gloria Stuart, Suzy Amis, Bill Paxton, Lewis Abernathy u.a. Länge: 194 Minuten. FSK: freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD und Blu-Ray erhältlich.
Titanic.
US. 1997. Buch und Regie: James Cameron. Mit: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher, David Warner, Jonathan Hyde, Charlotte Chatton, Gloria Stuart, Suzy Amis, Bill Paxton, Lewis Abernathy u.a. Länge: 194 Minuten. FSK: freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD und Blu-Ray erhältlich.
Story:
Die hundertjährige Rose erzählt in der Gegenwart einigen Meerestauchern von ihren Erlebnissen auf der Titanic und wie sie ihre große Liebe Jack Dawson kennenlernte.
Meinung:
Eigentlich sollten sich einleitende Worte erübrigen, wenn es um diesen Film geht. Wer kennt ihn denn schon nicht, den Film, der lange Zeit der erfolgreichste Filme war und der ein seltsames Phänomen begründet. Es gibt keinen anderen Film, bei dem von der Gesellschaft von einem Mann so krampfhaft erwartet wird, dass er ihn nicht mag. Es gibt keinen anderen Film, bei dem man sich als Filmfan so sehr fühlt, als müsse man sich schämen, wenn man ihn mag. Der Filmtitel scheint rhetorisch mit den Worten „Echt!?“ und „Nee, oder?“ untrennbar verbunden zu sein. Nicht so bei den Muscheln, euren mutigen Helden, die einmal reinen Tisch machen wollen. Mit einem Film und der unverständlichen Reaktion vieler Eingeweihten und Unwissenden.
Eigentlich sollten sich einleitende Worte erübrigen, wenn es um diesen Film geht. Wer kennt ihn denn schon nicht, den Film, der lange Zeit der erfolgreichste Filme war und der ein seltsames Phänomen begründet. Es gibt keinen anderen Film, bei dem von der Gesellschaft von einem Mann so krampfhaft erwartet wird, dass er ihn nicht mag. Es gibt keinen anderen Film, bei dem man sich als Filmfan so sehr fühlt, als müsse man sich schämen, wenn man ihn mag. Der Filmtitel scheint rhetorisch mit den Worten „Echt!?“ und „Nee, oder?“ untrennbar verbunden zu sein. Nicht so bei den Muscheln, euren mutigen Helden, die einmal reinen Tisch machen wollen. Mit einem Film und der unverständlichen Reaktion vieler Eingeweihten und Unwissenden.
Es sind nämlich (so scheint es, so muss es sein) hauptsächlich Menschen, die den Film gar nicht gesehen haben, aber der Meinung sind, darüber abkotzen und im „lustigsten“ Fall die sexuelle Orientierung des männlichen „Titanic“-Fans in Frage zu stellen. Dabei scheinen diese militanten Augenverschließer gar nicht zu wissen oder gar wissen zu wollen, was ihnen entgeht, wenn sie sich bewusst unter dem Druck eines verklärten (halb-)allgemeinen Tenor dem Film nicht offenbaren. Denn auch wenn der Film zugegebenermaßen voll und ganz auf seine emotional wuchtige Kraft baut, funktioniert das Werk von James Cameron auch in Gedanken, auf dem Papier und in einer analysierbaren Facette. Der Ozeanriese funktioniert als eine Metapher für den Menschen und seine immer spitzer zulaufende Vorstellung von einem Leben. Die Gier, die Fantasie der Macht, die Maximierung des Seins und der leichtfertige Umgang mit eben diesen Eigenschaften vereinen sich zu einem Schiff, das traumhaft anzusehen ist und verblendet. Rose fragt den Herren, der die RMS Titanic entworfen hat, ob Sigmund Freud ihm etwas sage. Er verneint. Aber die machohafte Einstellung ist deutlich geworden und wird immer wieder deutlich, wenn die Männer das Schiff als „sie“ bezeichnen und auf dem Deck nach der Kollision mit Eisbrocken Fußball gespielt wird.
 |
| "Was, es gibt hier keine Bildunterschriften?! Aber wieso???" |
Zugegeben, all das kann man schnell übersehen, wenn man einen 180-Minüter schaut, der einem auch diese Hintergründe nicht ins Ohr schreit, sondern entdeckt werden müssen. Aber selbst wenn man den Hintergrund beiseitelässt und sich nur auf die emotionale Komponente des Werkes konzentriert, selbst dann nimmt der Film mit seiner monumentalen Größe gefangen. Es ist einer der größten Stärken von James Camerons Arbeit: Er wiegt den Zuschauer zunächst seicht in er Hand, gibt ihm etwas Zeit, um es sich gemütlich zu machen und begeht mit ihm dann eine Rundfahrt, die ihresgleichen sucht. Camerons Griff schlingt sich immer fester zu und seine Schritte werden immer größer, aber man ist gezwungen mitzuhalten und anfangs scheint eben dies auch noch federleicht vonstatten zu gehen. Und auch wenn der Film altbekannt ist und man alle Szenen und kleineren Sätze mitsprechen und die Lieder mitsammen kann, ist man gebannt, hat Spaß und blendet komplett alles aus, was noch so kommen mag. Bei der 80-Minuten-Marke ist es dann schließlich so weit. Rose soll ihre Augen schließen und Jack vertrauen, er breitet ihre Arme aus und gemeinsam fliegen sie in ihre eigene Welt, in der Freiheit existiert und Rose sich von ihren gesellschaftlichen Fesseln befreien kann, obwohl sie eigentlich privilegiert ist. In solchen Momenten kann der Film seine ganze Kraft auf den Zuschauer einwirken lassen.
„Titanic“ hilft es sicherlich, dass die Produktionshintergründe so bombastisch und erstklassig sind, sodass Effekte, Dramaturgie, Schauspieler, Kostüm, Beleuchtung und Musik wirklich ziemlich ausgefeilt bis herausragend sind. Aber doch scheint es letztendlich Camerons fähige Führung zu sein, die alle Elemente verbindet und vor einem realen Hintergrund ein dreistündiges Theaterstück inszeniert, das Drama, Katastrophe, Coming of Age und Romantik ebenso elegant wie wirkungsvoll verbindet, sodass die 180 Minuten auch bei der zehnten Sichtung noch immer flüssig über die Bühne gehen. Das Schiff transformiert zu seinem Symbol des Menschen für Freiheit, Gier, Idiotie, Neid, Liebe und Gefühl. Es ist ein weitreichender Mix, aber einer, der jedem Element die gleiche Aufmerksamkeit und das gleiche Können widmet, wie den anderen, sodass letzten Endes nirgends Einsparungen auszumachen sind. Das verdient Respekt und Anerkennung und nicht etwa Häme, unerklärten Hass oder Ignoranz. Ein letztes Wort soll noch James Horner gebühren, der gestern ums Leben kam. Seine Musik ist es, die bleibt und die Jahre überdauern wird und die mit einem Menschen unglaubliche Dinge anstellen kann. Ihre Pracht, Präzision und Perfektion fließt in diesem Werk mit den Bildern ineinander und lässt einen mehr fühlen, als man erwarten würde. „Titanic“ ohne Horner? Möchte man sich nicht vorstellen.
9 von 10 french girls
von Smooli