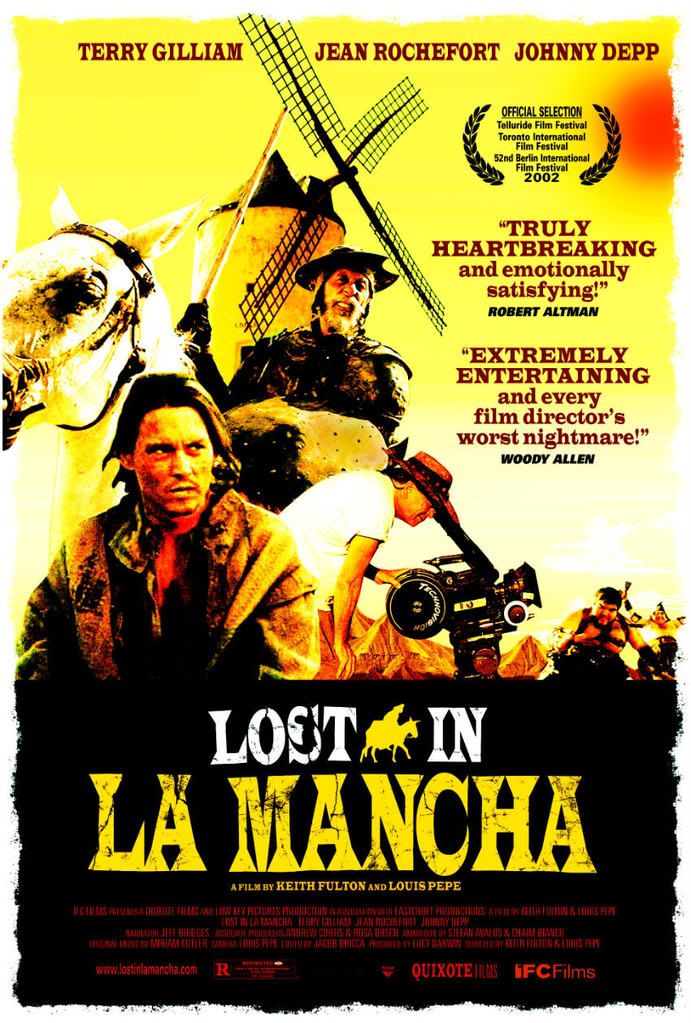Fakten:
The Zero Theorem
UK. 2013. Regie: Terry Gilliam. Buch: Pat Rushin. Mit: Christoph Waltz, Mélanie Thierry, David Thewlis, Lucas Hedges, Matt Damon, Tilda Swinton, Peter Stormare, Ben Whishaw u.a. Länge: 107 Minuten. FSK: Freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD und Blu-ray erhältlich.
The Zero Theorem
UK. 2013. Regie: Terry Gilliam. Buch: Pat Rushin. Mit: Christoph Waltz, Mélanie Thierry, David Thewlis, Lucas Hedges, Matt Damon, Tilda Swinton, Peter Stormare, Ben Whishaw u.a. Länge: 107 Minuten. FSK: Freigegeben ab 12 Jahren. Auf DVD und Blu-ray erhältlich.
Story:
In einer nicht näher benannten Zukunft sucht der Programmierer Qohen Leth abseits seiner Arbeit nach dem Sinn des Lebens. Die Suche nach dem alles erklärenden „Zero Theorem“ wird für ihn dabei mehr und mehr zur Obsession.
Meinung:
Terry Gilliams "The Zero Theorem", der nach "Brazil" und "Twelve Monkeys" den Abschluss der sogenannten Orwell-Trilogie bildet, ist selbst für Gilliams Verhältnisse ein eigensinniger Film. Das fällt vor allem dann auf, wenn man versucht, die Handlung zusammenzufassen: Der soziophobe und latent autistisch wirkende Qohen (großartig dargestellt von Christoph Waltz) arbeitet für ein großes Unternehmen am sogenannten Zero Theorem, während er privat fieberhaft auf einen mysteriösen Anruf wartet. Punkt. Das ist, grob gesagt, die Handlung. Doch worin genau besteht Qohens Arbeit? Was ist sein Hintergrund, sein Werdegang? Was steckt hinter dem Zero Theorem? Und welchen Plan verfolgt der Chef des Unternehmens (Matt Damon), für das Qohen arbeitet?
Terry Gilliams "The Zero Theorem", der nach "Brazil" und "Twelve Monkeys" den Abschluss der sogenannten Orwell-Trilogie bildet, ist selbst für Gilliams Verhältnisse ein eigensinniger Film. Das fällt vor allem dann auf, wenn man versucht, die Handlung zusammenzufassen: Der soziophobe und latent autistisch wirkende Qohen (großartig dargestellt von Christoph Waltz) arbeitet für ein großes Unternehmen am sogenannten Zero Theorem, während er privat fieberhaft auf einen mysteriösen Anruf wartet. Punkt. Das ist, grob gesagt, die Handlung. Doch worin genau besteht Qohens Arbeit? Was ist sein Hintergrund, sein Werdegang? Was steckt hinter dem Zero Theorem? Und welchen Plan verfolgt der Chef des Unternehmens (Matt Damon), für das Qohen arbeitet?
 |
| Qohen ist in guten Händen |
Es gibt Dinge, in denen sich kein intrinsischer Sinn erkennen lässt. Das Leben ist eines davon. "The Zero Theorem", wenn man ihn von all jenen 'klassischeren' Genreelementen befreit, die er durchaus auch besitzt (Überwachungswahn, virtuelle Realitäten, übermächtige Konzerne, et cetera), ist daher im Kern ein zutiefst existentialistischer Film. Dabei vermeidet das Drehbuch von Pat Rushin jeglichen Selbstfindungskitsch, aber auch allzu großen Zynismus, und verdeutlicht anhand des Protagonisten und dessen schwieriger Sinnsuche vor allem eines: Leben bedeutet "zur Freiheit verurteilt zu sein" (Jean-Paul Sartre). Dass dies in extremen Fällen in eine einzige bedrohliche Angstspirale führen kann, führt der Film uns ebenso vor Augen wie die stets vorhandene Möglichkeit des Ausstiegs aus derselben. Wie ein solcher Ausstieg aus dem Gefühl existentieller Verlassenheit aussieht, wissen wir nicht einmal - auch nicht in Bezug auf Qohens konkreten Fall - dann, wenn der Abspann läuft, denn dazu werden gegen Ende verschiedene Realitäts- und Wahrnehmungsebenen zu sehr verwischt. Im Geiste des Filmes heißt es somit schließlich für den Zuschauer, sich seinen eigenen Sinn des Ganzen zu konstruieren. Wo die Arbeit von Gilliam und Konsorten endet, beginnt die Arbeit im Kopf des Rezipienten. Das ist Genrekino mit Anspruch.
7 von 10 virtuellen Zahlenwürfeln
von Ben Kenobi