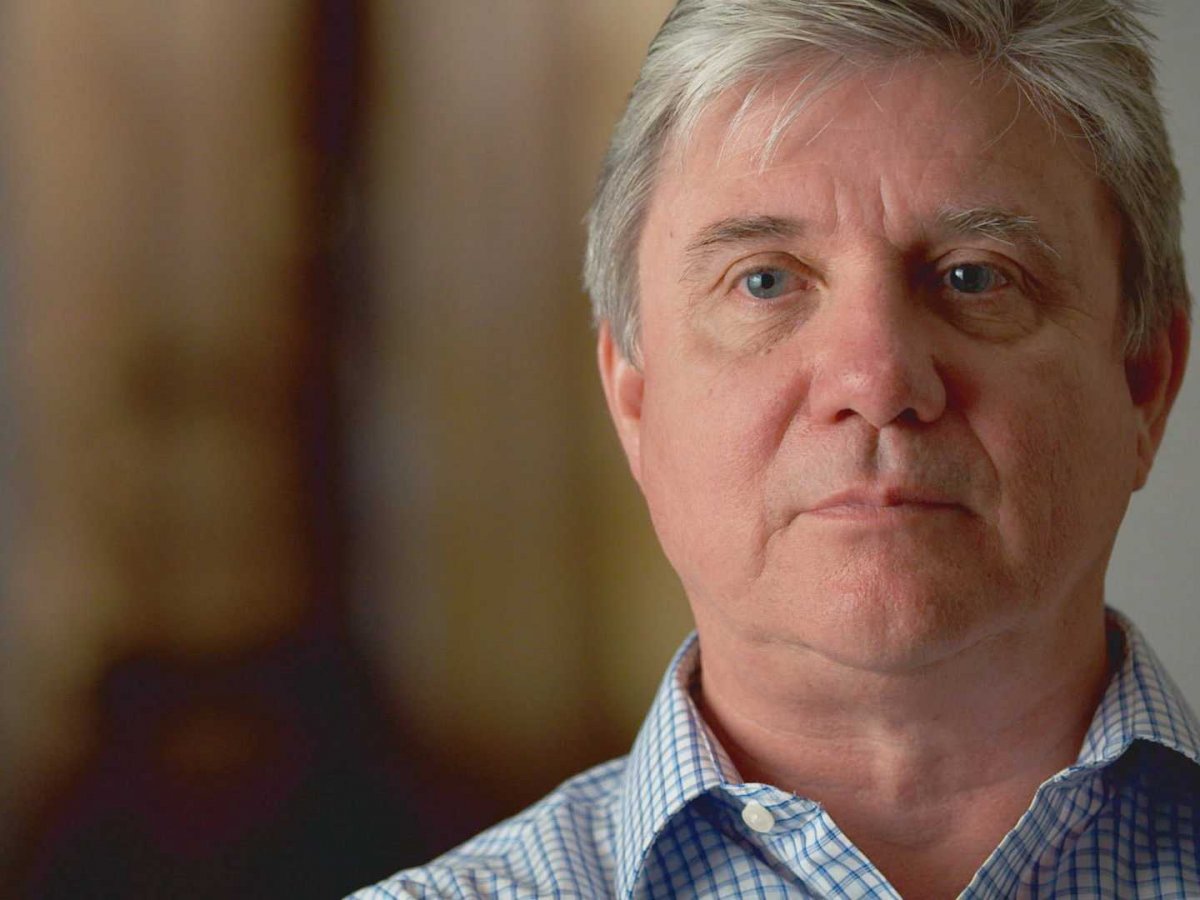Fakten:
Game of Thrones – Staffel 5
USA. 2015. Regie: David Nutter, Michael Slovis, Mark Mylod, Jeremy Podeswa, Miguel Sapochnik. Buch: D.B. Weiss, David Benioff, Bryan Cogman, Dave Hill, George R. R. Martin (Vorlage). Mit: Kit Harrington, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Lena Headey, Liam Cunningham, Sophie Turner, Alfie Allen, Aiden Gillen, Iwan Rheon, Iain Glen, Maisie Williams, Nicolaj Coster-Waldau, Jerome Flynn, John Bradley, Conleth Hill, Natalie Dormer, Carice van Houten, Stephen Dillane, Gwendoline Christie, Dean-Charles Chapman, Michiel Huisman, Indira Varma, Tom Wlaschiha, Michael McElhatton, Jonathan Pryce u.a. Länge: 10 Episoden a ca. 50 Minuten. FSK: freigegeben ab 16 Jahren. Demnächst auf DVD und Blu-ray erhältlich.
Game of Thrones – Staffel 5
USA. 2015. Regie: David Nutter, Michael Slovis, Mark Mylod, Jeremy Podeswa, Miguel Sapochnik. Buch: D.B. Weiss, David Benioff, Bryan Cogman, Dave Hill, George R. R. Martin (Vorlage). Mit: Kit Harrington, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Lena Headey, Liam Cunningham, Sophie Turner, Alfie Allen, Aiden Gillen, Iwan Rheon, Iain Glen, Maisie Williams, Nicolaj Coster-Waldau, Jerome Flynn, John Bradley, Conleth Hill, Natalie Dormer, Carice van Houten, Stephen Dillane, Gwendoline Christie, Dean-Charles Chapman, Michiel Huisman, Indira Varma, Tom Wlaschiha, Michael McElhatton, Jonathan Pryce u.a. Länge: 10 Episoden a ca. 50 Minuten. FSK: freigegeben ab 16 Jahren. Demnächst auf DVD und Blu-ray erhältlich.
Story:
Der Kampf um den eisernen Thron geht weiter. Während Tyrion auf der Flucht ist und scheinbar eine neue Heimat auf Essos findet, beginnt Arya ihre Ausbildung als Meuchelmörderin. Jaime Lannister fürchtet sich währenddessen vor der Rache Dornes und begibt sich auf die Reise seine Nichte Myrcella zurück in die Heimat zu holen und auch in Königmunds und im Rest von Westeros bahnen sich gefährliche Konflikte an.
Meinung:
Die „Schachbrett“-Metapher ist natürlich unlängst eine altbackene: Menschen, die sich als Figuren auf einem überdimensionalen Schachbrett wiederfinden und von einem übermächtigen Spieler von Kachel zu Kachel gepeitscht werden. Für das HBO-Format „Game of Thrones“ aber hat diese Metapher inzwischen über (nunmehr) fünf Staffeln derart an Bedeutung und Signifikanz gewonnen, dass es kaum möglich scheint, den individuellen Status im ausufernden Figurenarsenal noch wirklich differenzieren zu wollen respektive zu können: Wenn ein Charakter royaler Beschaffenheit ebenso kaltschnäuzig über die Klinge springen muss, wie es der nicht weniger für ein intaktes Gesellschaftssystem ausschlaggebende Pöbel tut, dann wissen wir: Hier gibt es keine Sonderrechte. Problematisch an diesem archaischen Worldbuilding und seinen inhärenten Herrschaftsansprüchen wird es nun in Staffel 5: Sicherlich haben sich die Verantwortlichen der Serie schon in der Vergangenheit den ein oder anderen herberen Bock geleistet, wenn es darum geht, George R. R. Martins komplexen Erzählbogen gekonnt zu adaptieren. Doch in Staffel 5 wirkt es, als wären David Benioff und D. B. Weiss einem gescheiterten Emanzipationsversuch anheimgefallen.
Die „Schachbrett“-Metapher ist natürlich unlängst eine altbackene: Menschen, die sich als Figuren auf einem überdimensionalen Schachbrett wiederfinden und von einem übermächtigen Spieler von Kachel zu Kachel gepeitscht werden. Für das HBO-Format „Game of Thrones“ aber hat diese Metapher inzwischen über (nunmehr) fünf Staffeln derart an Bedeutung und Signifikanz gewonnen, dass es kaum möglich scheint, den individuellen Status im ausufernden Figurenarsenal noch wirklich differenzieren zu wollen respektive zu können: Wenn ein Charakter royaler Beschaffenheit ebenso kaltschnäuzig über die Klinge springen muss, wie es der nicht weniger für ein intaktes Gesellschaftssystem ausschlaggebende Pöbel tut, dann wissen wir: Hier gibt es keine Sonderrechte. Problematisch an diesem archaischen Worldbuilding und seinen inhärenten Herrschaftsansprüchen wird es nun in Staffel 5: Sicherlich haben sich die Verantwortlichen der Serie schon in der Vergangenheit den ein oder anderen herberen Bock geleistet, wenn es darum geht, George R. R. Martins komplexen Erzählbogen gekonnt zu adaptieren. Doch in Staffel 5 wirkt es, als wären David Benioff und D. B. Weiss einem gescheiterten Emanzipationsversuch anheimgefallen.
 |
| Margery scheint auch nichts die Laune verderben zu können |
 |
| Mit dem Bart ist Tyrion nicht mehr von den anderen zu unterscheiden |
 |
| Ach ja, die gibt's in Westeros ja auch noch, diese White Walker |
Es wäre aber eine Lüge, würde man sie verleugnen, die immer noch vorhandenen Qualitäten der Serie: Das Torpedieren von Identifikationsfiguren bleibt ungemein interessant, schauspielerisch ist „Game of Thrones“ indes nicht nur größtenteils grandios, die fünfte Staffel kann sich auch wieder als fördernde Plattform dafür verstehen lassen, Darstellern aus der zweiten Reihe eine Bühne zu verleihen, um einmal mehr bis in die vorderste Front zu strahlen. Und auch wenn es etwas zu spät kommt, muss man zweifelsohne zugeben, dass die letzten drei Folgen der Staffel wieder in der bestechender Form auftreten, weswegen man einst begonnen hat, die Serie in sein Herz zu schließen. Inszenatorischer wie emotionaler Höhepunkt ist dabei nicht nur die finale Szene und die auf Jon Snows leerem Blick verharrende Kamera, sondern eindeutig Cerseis 15-minütiger Walk of Shame, der die Prophezeiung, Cersei würde irgendwann alles verlieren, bewahrheitet: Komplett entkleidet muss sie sich dem Volk stellen und durch ihre demütigende Mitte schreiten, ein schier unendlicher, von verbaler, körperlicher und seelischer Gewalt geprägter (Buß-)Gang, an dessen Ende der rote Bergfried wartet. Vermutlich sind das die kraftvollsten Minuten, die die Serie bisher zustande gebracht hat – und der Fingerzeig, welch ungeahnte Intensität doch in jeder Folge freigelegt werden könnte. Könnte
5 von 10 unverzeihlichen Opfergaben
von souli